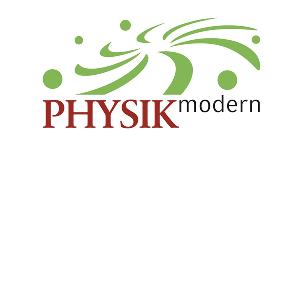
Quantenstrukturen unter der Lupe: Elektronenmikroskopie (sub) atomarer Welten
(Prof. Dr. Knut Müller-Caspary, LMU München)
In 2031 wird die Elektronenmikroskopie ihr 100 jähriges Jubiläum seit der Erfindung Ernst Ruskas feiern. Sowohl die Geschichte der Elektronenmikroskpie als auch ihre Anwendungen auf Quantensysteme und Streuprobleme führen uns auf einen Streifzug durch die Quantenphysik: In modernen Mikroskopen liefert die Kombination von Welleneigenschaften mit elektronenoptischen Aberrationskorrektoren Auflösungen von 0,5 Angstrom und eröffnet so den Blick bis in subatomare Dimensionen. Neben der nunmehr fast routinemäßigen Beantwortung der paradigmatischen Frage "Welches Atom befindet sich wo?" in Quantenpunkten, Nanodrähten oder 2D-Materialien zeigt dieser Beitrag, wie atomare elektrische Felder und Polarisationsladungsdichten direkt vermessen werden können - etwa um chemische Bindungseffekte oder die physikalischen Grundprinzipien ferroelektrischer Datenspeicher oder von Lasern zu verstehen. Dazu werden neueste Entwicklungen der multidimensionalen Elektronenmikroskopie skizziert, in welcher simultan Beugungs- und Ortsrauminformation aufgenommen und bis zur Heisenberg'schen Unschärfegrenze interpretiert werden kann. Aus Datenraten von bis zu 1 Mio Bildern/s am Elektronenmikroskop der LMU in Großhadern errechnen eigens entwickelte Algorithmen zur Lösung der Schrödingergleichung Strukturen mit Auflösungen im Bereich der thermischen Bewegung der Atome - weit unterhalb des durch die Elektronenoptik vorgegebenen Limits. Schließlich zeigen diese aus physikalischen Grundprinzipien entwickelten Methoden derzeit enormes Potential bei der Untersuchung biologischer Proben wie Proteinen als ein weiteres Beispiel des interdisziplinären Charakters - und Auftrags - der Elektronenmikroskopie.
